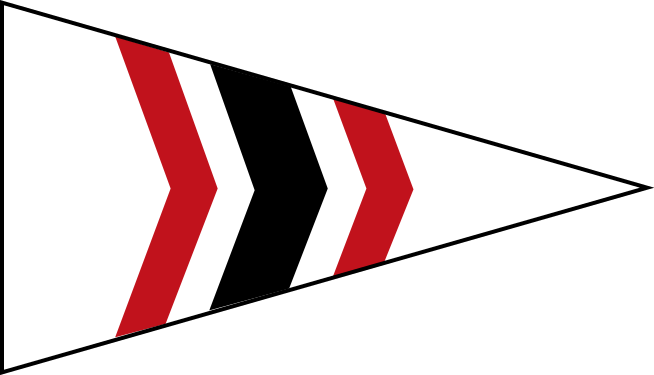Es muss sich ja nicht immer alles ums Segeln drehen. Im Januar besuchten wir das Atommüll-„Endlager“ Asse.
Eines kann man den Betreibern der Asse wirklich nicht vorwerfen: Schlechte Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt dort ein eigenes Informationszentrum mit Modellen, Schautafeln, Videos und gut gemachten Broschüren. Und kostenlose Gruppenführungen.Grund genug, sich Deutschlands prominentestes Atomklo mal näher anzuschauen. Hanno Müller, der die Asse schon von einer früheren Exkursion kannte, hatte uns einen Termin Mitte Januar besorgt. Die Liste mit 14 Teilnehmern war schnell voll.
Der Besuch erwies sich als kompletter Tagestörn. Mal eben reinfahren und rumschauen läuft nicht bei einem Bergwerk, das noch in Betrieb ist. Für uns bedeutet das: Sicherheitscheck und Sicherheitseinweisung über sich ergehen lassen; weiße Bergmannskluft einschließlich Feinripp-Unterwäsche anziehen; Dosimeter, Helm, Lampe und Sauerstoff-Selbstretter in Empfang nehmen.
Da der Förderkorb uns nicht alle auf einmal fasst, geht es in zwei Gruppen auf Tiefe. 490 Meter tiefer stehen wir staunend vor einem gigantischen Salzhobel, etwa so groß wie zwei Planierraupen. Wie ist er dort bloß hier hingekommen? Genauso wie wir: Durch den Förderkorb. Im Gegensatz zu uns allerdings in Einzelteile zerlegt. Auch die Mercedes-Transporter, die uns dann auf engen Serpentinen bis auf die unterste 750-Meter-Sohle kutschierten, mussten Federn lassen. Schweißnähte in den Fenstersäulen zeugen davon, dass ihr Dach kurzerhand abgeflext und untertage wieder angeschweißt wurde.
Was gab es dort unten nun zu sehen? Um es gleich vorwegzunehmen: Nein, uns sind keine verbeulten gelben Stahlfässer vor den Füßen herumgekullert. Wir kamen nicht einmal in die Nähe der eigentlichen Einlagerungskammern, denn das wäre mit noch größerem Sicherheits-Bohei verbunden. Aber zu sehen und zu fühlen gab es trotzdem genug. Zum Beispiel eine stickig-warme, salzhaltige Luft, in der man sich schnell wieder nach dem schmuddeligen Winterwetter an der Oberfläche sehnte. Auch diese Luft muss durch den Aufzugschacht herein und heraus. Damit es dabei nicht zieht, gibt es überall gewaltige gelbe Luftschleusen, groß wie Scheunentore.
Das eigentliche Problem der Asse können wir auf der 490-Meter-Sohle besichtigen: Wasser. Gartenteichgroße Becken fangen die rund zwölf Kubikmeter auf, die täglich von außen eindringen. Von den Becken wird das Wasser nach oben gepumpt und dort mit Tankwagen weggeschafft. Da sich der meiste Atommüll sehr viel tiefer befindet – auf 750 Metern – ist das Wasser hier oben noch nicht radioaktiv. Doch in der Bilge der unteren Sohle sammelt sich auch verseuchte Flüssigkeit. Zwar nur wenige Eimer pro Tag, aber immerhin: Irgendwo kommt Wasser offenbar in direktem Kontakt zu strahlendem Material.
Wo und wie genau, darüber ist wenig bekannt. Bisher wurden nur wenige Kammern angebohrt. Die gute Nachricht: Es scheint sich dort wenigstens kein explosives Gasgemisch gebildet zu haben. Die schlechte: Bis der Müll geborgen werden kann, werden noch Jahrzehnte vergehen. Erst im Jahr 2033 soll es frühestens losgehen.
Bis dahin ist das Bergwerk vor allem mit sich selbst beschäftigt. Schließlich wurde schon vor mehr als hundert Jahren damit begonnen, dort Natrium- und Kaliumchlorid abzubauen. Entsprechend marode ist die Asse. Ständig werden Hohlräume verfüllt und Strecken gesichert, aber für die Rückholung sind die bestehenden Stollen und Schächte trotzdem zu alt oder zu klein. Deshalb muss neben das bestehende Bergwerk gewissermaßen noch mal ein komplett neues gebaut werden, mit einem eigenen Förderschacht, von dem aus die Einlagerungskammern dann schräg von oben angebohrt werden können.
Parallel dazu arbeitet der Betreiber der Asse, das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), noch an einem Plan B. Zwar ist es der erklärte politische Auftrag, den Atommüll zurückzuholen. Doch wenn es zuvor einen massiven, nicht beherrschbaren Wassereinbruch gibt – den niemand ausschließen kann –, dann soll das gesamte Bergwerk mit einer Magnesiumchlorid-Lösung geflutet werden. Sie ist schwerer als die Kochsalz-Lösung die sich beim Wassereinbruch bildet und soll verhindern, dass radioaktives Material aufsteigt.
Angesichts dieser Zeiträume spielt es fast schon keine Rolle mehr, dass es nicht nur keine Pläne für ein oberirdisches Zwischenlager gibt, sondern dass die Planung dafür sogar eingefroren wurde. Das BfS möchte den zurückgeholten Müll am liebsten direkt auf dem Zechengelände zwischenlagern und umpacken, bevor er dann in ein richtiges Endlager kommt, wahrscheinlich in den Schacht Konrad bei Salzgitter. Logisch – so würden die nötigen Atommülltransporte auf ein Minimum reduziert. Die Bevölkerung vor Ort ist dagegen. Sie fühlt sich schon zu lange als Atommüllkippe der Nation missbraucht. Auch logisch.
Nach etwa eineinhalb Stunden Führung zu Fuß und im Bus heißt es für uns mal wieder Schlange stehen: Jeder einzelne muss sich „freimessen“ lassen, wie es im Kernkraft-Jargon heißt. Dazu folgt man den Anweisungen einer strengen synthetischen Stimme und steckt seine Hände tief in einen Blechkasten. Das dauert jedes Mal eine gefühlte Ewigkeit, doch schließlich lässt uns die digitale Domina passieren. Auch unsere Dosimeter geben grünes Licht – sie zeigen null komma nullnullnull Sievert an.
Geduscht und wieder in Zivil interessiert uns auf der Abschlussbesprechung natürlich vor allem eine Frage: Wie konnte es soweit kommen? Man muss sich das mal vorstellen: Das radioaktive Material und seine Zerfallsprodukte strahlen länger, als es die Gattung Homo Sapiens überhaupt gibt. Hätten die Neandertaler Nukleartechnik besessen – ihre Hinterlassenschaften wären heute noch lange nicht abgebaut. Um solche unfassbaren Zeiträume geht es bei der Kernkraft. Und trotzdem reichte die Planungssicherheit der Asse nicht mal eine einzige Menschengeneration weit.
Natürlich ist es billig, hinterher schlauer zu sein. Aber hätte man nicht schon in den sechziger Jahren wissen können, dass ein Endlager in einem durchlöcherten Uraltbergwerk keine ganz so clevere Idee ist? Unser Betreuer stellt zwar klar: „In der Asse hätte nie Atommüll eingelagert werden dürfen.“ Aber der Frage nach den damaligen Versäumnissen und Verantwortlichkeiten weicht er aus. Dies sei halt eine andere Zeit gewesen, und man könne es nun eh nicht mehr ändern.
Deutlicher äußern sich da die Infobroschüren des BfS, die im Besucherzentrum ausliegen. Sie lassen den Schluss zu, dass die Risiken der Asse damals im Prinzip schon bekannt waren, sich aber schlicht niemand dafür interessiert hatte. Die Politik wollte ein Endlager haben, und die Asse war billig zu haben. Ursprünglich war sie als Forschungsbergwerk deklariert. Doch spätestens, seit die Fässer dort nicht mehr sauber gestapelt, sondern nur noch abgekippt wurden, hat sie sich stillschweigend in ein Endlager verwandelt, weil das Zeug nicht mehr so einfach zurückzuholen war. Und wenn die Strahlung einer Atommüll-Lieferung über dem Grenzwert für eine Einlagerung lag, wurde einfach der Grenzwert erhöht.
Könnte so etwas heute wieder passieren? In der Asse selbst wohl nicht. Hier haben wir den Eindruck, dass mittlerweile jeder Schritt peinlich genau dokumentiert und kommuniziert wird. Aber in anderen Kernkraftanlagen, die weniger im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen? Darauf würde ich keinen rostigen Schäkel verwetten. Ziemlich nachdenklich machen wir uns auf den Heimweg.
Facts:
Der oberste Asse-Verantwortliche – BfS-Chef Wolfram König – ist Mitglied der Grünen und erklärter Kernkraftgegner.
8,6 Millionen Euro haben die Verursacher des Atommülls umgerechnet insgesamt an Einlagerungsgebühren bezahlt. 1082 Millionen Euro hat der Betrieb der Asse von 1965 bis 2014 den Steuerzahler gekostet. Jedes Jahr kommen etwa 100 bis 120 Millionen hinzu.
In der Asse sind rund 48.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiver Atommüll gelagert. Klingt nach viel, aber die gesamte Strahlung (2.900.000 Gigabecquerel) entspricht nur 0,5 Prozent eines einzigen Castor-Behälters mit hochradioaktivem Abfall.
[ape-gallery 2145]